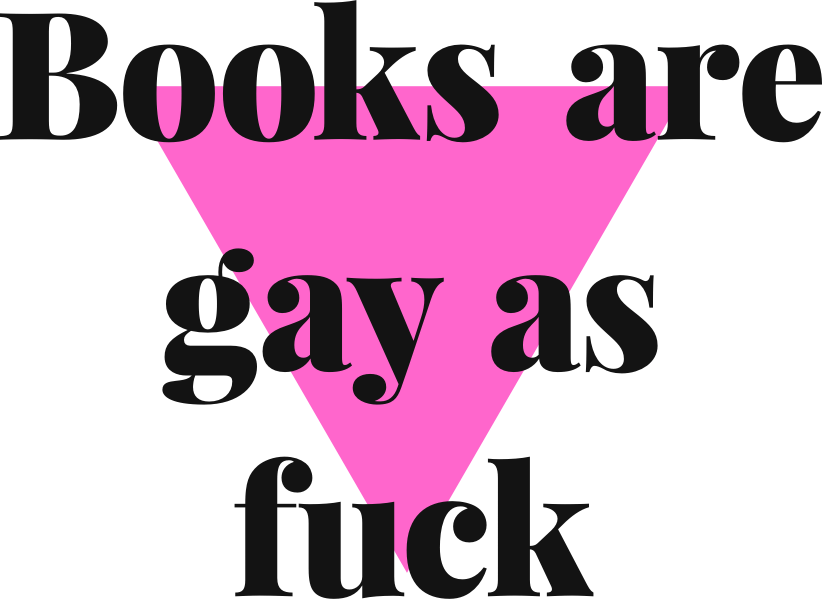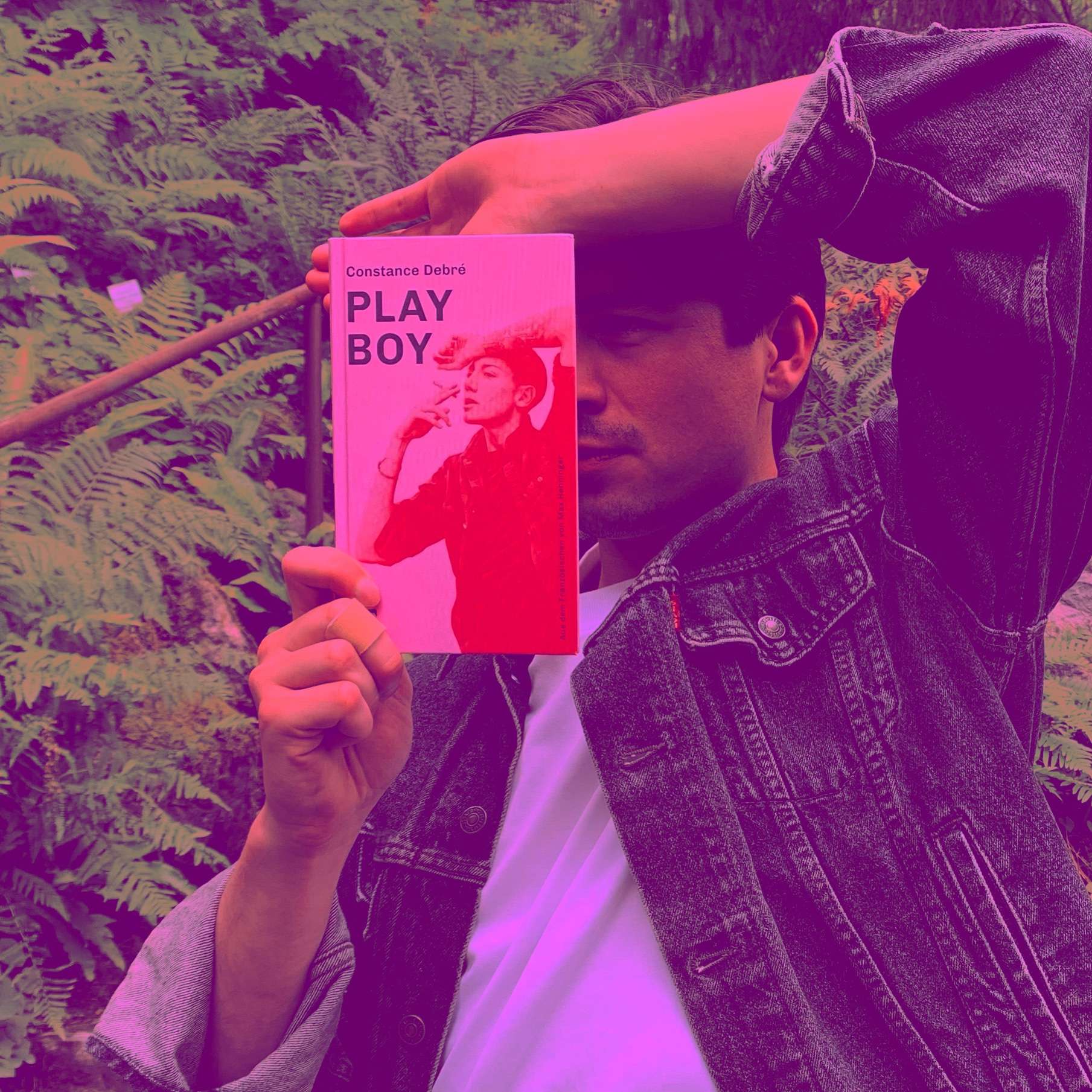„Mein Körper ist genau das, was ich bin. Das lag mir schon immer vor Augen. Ich hab mich mit ihr verglichen. Ich hab mich gesehen und sie, und all die anderen Frauen, die ich nicht bin. Die Schultern, das Weiche, Runde an ihr und an ihnen, das, was an mir nicht rund ist. Ich hab sie vermessen und mich selbst. Auch moralisch. Ich hab mir gesagt, eine Frau ist etwas, das ich mir nicht hätte ausdenken können. Etwas, das nackter und roher ist als Männer. Etwas, das immer an der Grenze zum Obszönen liegt.“
‚Play Boy‘ (aus dem Französischen von Max Henninger) ist der Auftakt der autofiktionalen Trilogie von Constance Debré, der die Vorgeschichte zu (dem ebenfalls bei Matthes & Seitz erschienenen und von Max Henninger übersetzten) ‚Love Me Tender‘ erzählt und der mit dem 2022 in Frankreich veröffentlichten ‚Nom‘ einen Abschluss gefunden hat. Hier beginnt Debré das Projekt, die eigene bürgerliche Identität zu demontieren, welches sie in ‚Love Me Tender‘ bereits perfektioniert hat. Nach 20 Jahren Ehe trennt sie sich von ihrem Ehemann, kündigt ihren Job als Anwältin, stählt ihren Körper durch das tägliche Schwimmen, rasiert sich den Schädel kahl und schläft nur noch mit Frauen. Kurzum: Sie wird zum Play Boy.
Im Zentrum des Romans stehen zwei Beziehungen zu Frauen, welche die Protagonistin nach der Trennung von ihrem Ehemann eingeht, aber auch wie sich ihre Beziehung zur Welt und zu ihrem Körper ändert, nachdem sie mit jeglichen bürgerlichen Normen bricht und beginnt die Privilegien aufzugeben, die mit dem Erhalt eben jener einhergehen: „Ich liebe die Schuldigen, die Pädophilen, die Diebe, die Vergewaltiger, die Bankräuber, die Mörder. Bei den Unschuldigen und den Opfern weiß ich nicht, wie ich sie verteidigen soll. Was mich fasziniert, ist nicht die Schuld, sondern zu sehen, wie tief ein Mensch abstürzen kann. Ohne ein Wort zu sagen und ohne eine Miene zu verziehen. So abzustürzen, erfordert besonderen Mut.“
Diese Verkehrung der Moral ist der französischen Literatur durchaus bekannt, Jean Genet hat dies immerhin zum Herzstück seines Werkes gemacht. Nur, dass diese Verkehrung hier vom anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums ausgeht, da Debré kein Findelkind des Staates ist, sondern aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammt (mit „sogar ein paar Herzoginnen im Stammbaum, auf der mütterlichen Seite“). Debrés Projekt geht aber über die bloße Verkehrung von sozialen und moralischen Normen hinaus: „Winzige Veränderungen, die sich summiert haben, die kurzen Haare, die Tätowierungen, eine kleine Häufung von Details, die meine Art zu gehen und zu sprechen verändert haben, vielleicht auch meine Art zu denken. Ich hab be-merkt, dass ich mich nicht mehr für dieselben Bücher interessierte, dass ich nicht mehr verstand, warum mir Proust und all die anderen so viel bedeutet hatten, dass ich mein Viertel zu wohlhabend fand, zu sauber, zu hübsch, dass ich zwar immer schon Jeans und T-Shirts getragen hatte, aber wohl auf andere Weise, und dass ich bei etwas schickeren Anlässen nicht mehr wusste, was ich anziehen sollte, dass es mich jetzt anstrengte, die alten Codes zu wahren.“
Indem sich Debrés Protagonistin von den materiellen Dingen löst, löst sie sich von den damit einhergehenden Zuschreibungen. Das ist natürlich auch Kapitalismuskritik, vor allem aber der Versuch Identität als Konzept komplett zu zerlegen. Dazu gehören – meiner Meinung nach – auch die Beziehungen zu anderen Menschen: „Ich beschloss, dass das, was zwischen ihr und mir passieren könnte, das Wichtigste in meinem Leben sein würde. Wer sie war, spielte dabei keine Rolle.“ Das, was bei Debré oft als Arroganz ausgelegt wird (und es bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch ist), scheint mir vielmehr der Versuch zu sein, Menschen neu zu begegnen, jenseits von Normen und Zuschreibungen, eine Begegnung, die aufgrund gesellschaftlicher Normen, Unsicherheiten und auch kollektiver Fantasien, wie eine glückliche Beziehung auszusehen hat, nur kompliziert ausfallen kann.
Es ist interessant, mit was für einer Abwehrhaltung viele Leser*innen diesem Text begegnen, wie sie Debrés Privilegiertheit kritisieren (die sie offen thematisiert), aber auch ihr Blick auf andere Frauen wird kritisch beäugt. Dieser wird als triebhaft und lüstern wahrgenommen, es kann immer noch nicht sein, dass eine Frau derart begehrt, dass sie mit Grenzen und Tabus bricht, dieser vermeintlichen Skrupellosigkeit kann nur mit einer misogynen Sexualmoral begegnet werden. Debré wagt mit ‚Play Boy‘ das Tabu, wie ein Mann zu begehren und sich mit ihnen zu vergleichen, ja, sich mit ihnen auf eine Stufe zu stellen: „Ein Frauenkörper ist dazu da, ihn mit der Hand und dem Mund zu berühren, eine Frau ist dazu da, gefickt zu werden. Brüste sind dazu da, berührt zu werden, ein Arsch ist dazu da, sich darin zu vergraben, eine Muschi ist dazu da, den Mund hineinzuschieben, den Duft zu riechen, die Zunge und die Finger hineinzustecken, den Geschmack zu lutschen, diesen verdammt süßen Geschmack. Kein Mann kann da mithalten. Ich verstehe Männer, die zu Nutten gehen. Ich verstehe sogar die Vergewaltiger. Zum ersten Mal spüre ich die ganze Gewalt des Verlangens wie einen Stich.“
Da die deutsche Übersetzung von ‚Play Boy‘ nach ‚Love Me Tender‘ erschienen ist, muss der Roman sich den direkten Vergleich mit seinem Nachfolger gefallen lassen, ein Vergleich, der nur zugunsten von ‚Love Me Tender‘ ausfallen kann. Aber auch wenn sich ‚Play Boy‘ ein wenig wie eine Trockenübung liest für das, was noch kommt, ist dies natürlich eine Entwicklung, wie man sie sich für Autor*innen wünscht. Besonders dramatisch ist es aber nicht, dass ‚Play Boy‘ noch nicht das volle Potential von Debrés Schreiben entfaltet. Denn bereits in ihrem Debüt schreibt sie einzelne Absätze, die spannender und radikaler als ganze Bücher, ja, vielleicht auch ganze Werke altbewährter Autor*innen sind. Bereits hier trieft jede Seite von der mit Worten nicht beizukommenden Coolness, die Debré eigen ist.