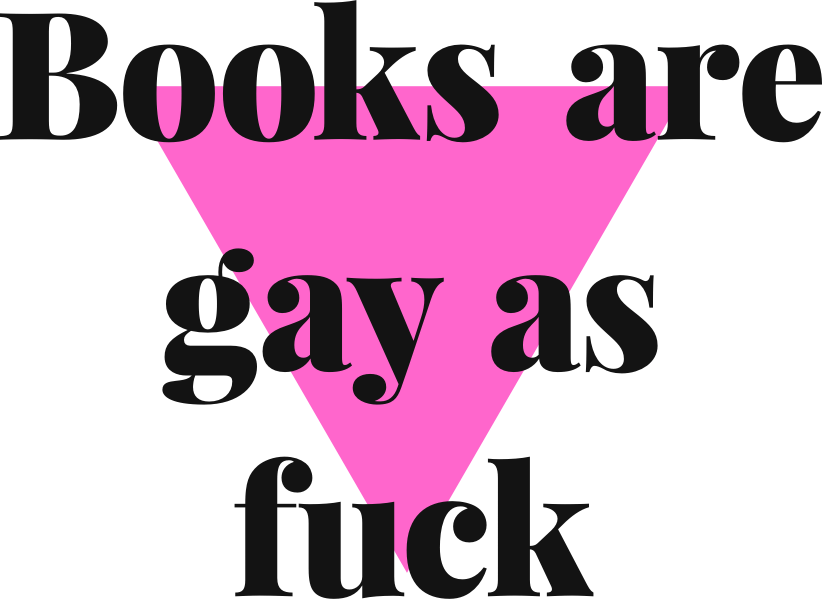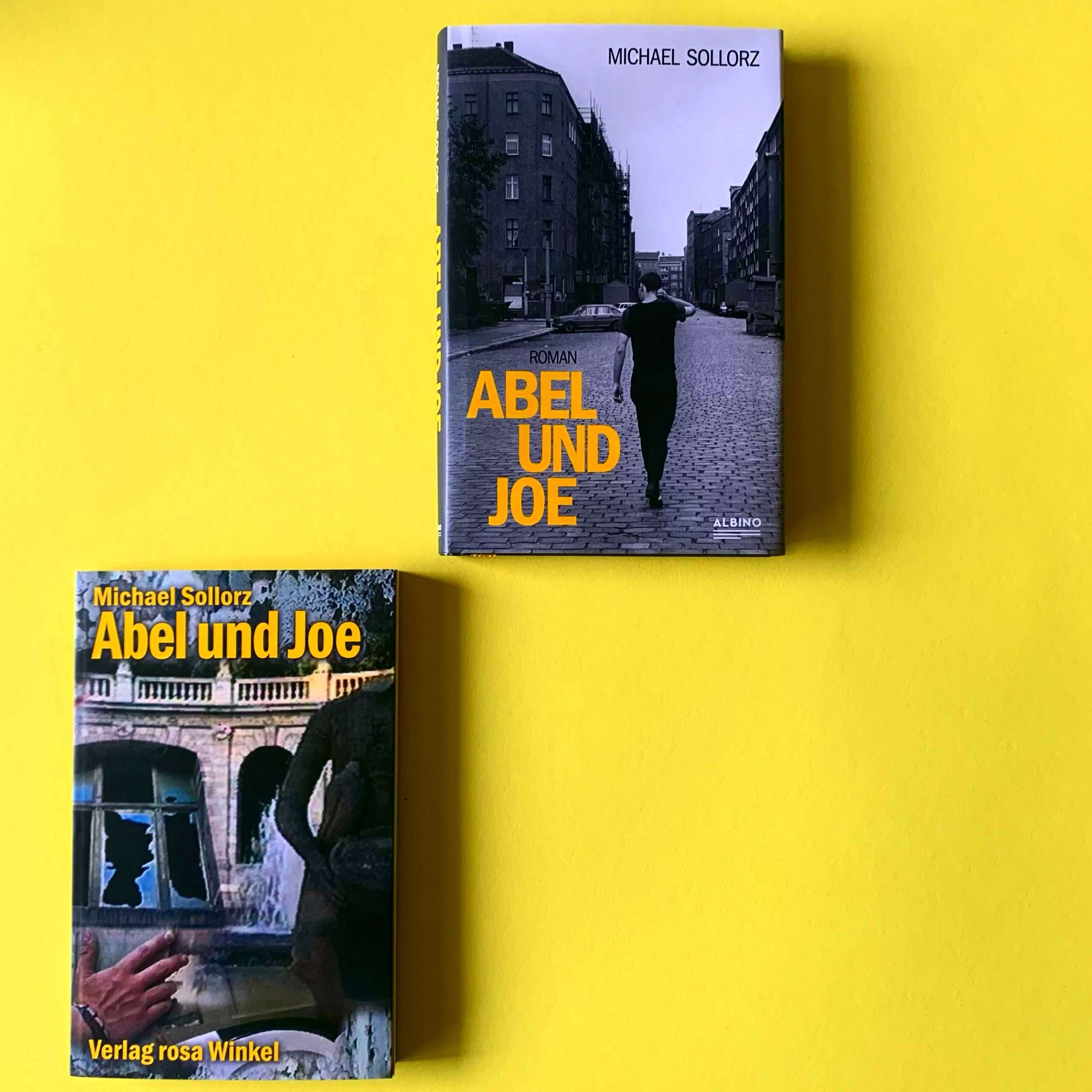„Er sprach noch nicht davon, die Stadt zu lieben, die schon jetzt, nach den ersten gemeinsamen Jahren, überall Spuren seiner Gegenwart trug. Verlässt er mich, dachte Abel manchmal, ertrage ich Berlin nicht mehr. Er wusste, Joe dachte ebenso. Die Stadt schien ihnen verzaubert, verwunschen durch den ersten Mann, mit dem sie Altwerden möglich nannten.“
Abel sucht Joe. Seit drei Tagen ist Joe nicht in die gemeinsame Wohnung in Friedrichshain zurückgekehrt und nun irrt Abel, ähnlich James Joyce‘ Ulysses, zwischen einem 28. und 29. August Anfang der 1990er Jahre durch Berlin, eine Stadt, deren Antlitz vom Fall der Mauer und der AIDS-Epidemie geprägt ist. ‚Abel und Joe‘ von Michael Sollorz gehört zu den Klassikern der deutschsprachigen schwulen Literatur, den nur noch Eingeweihte kennen – auch weil der ursprünglich 1994 veröffentlichte Roman im Verlag Rosa Winkel erschienen ist, den es seit 2001 nicht mehr gibt. Zum 30jährigen Jubiläum hat der Albino Verlag nun dankenswerterweise eine Neuauflage mit einem Nachwort von Katja Ostkamp (der Autorin des Bookstagram Favorites ‚Marzahn, mon amour‘) herausgebracht und macht den Roman nun endlich wieder einem neuen Publikum zugänglich. Glücklicherweise gibt es weiterhin viel in diesem ganz und gar wunderbaren Text zu entdecken.
Was passiert nach dem Happy End, wenn sich zwei endlich gefunden haben? Im Angesicht dieser Frage verhandelt ‚Abel und Joe‘ die (Un)möglichkeiten einer schwulen Beziehung. Das mag seltsam antiquiert klingen, immerhin gilt eine Infektion mit HIV allgemeinhin nicht mehr als Todesurteil, seit 2017 gibt es die Ehe für alle und auch eine offene Beziehung ist etwas, worüber man ganz, nun ja, offen reden kann. Doch es ist genau das Verhandeln dieser beiden Männer („Sie versuchten alles. Das Gemeinsam-Mitgehen. Das Mitnehmen. Das Dienstags-getrennt-Losziehn. Das Über-alles-Reden. Das Nichtwissenwollen.“), welches dem Text neben seiner historischen Komponente etwas Zeitloses verleiht. Und so ticken in Bad Beichte, von wo Joe herkommt, die Uhren noch anders: Von Joes Eltern wird Abel im besten Fall geduldet, im schlimmsten mit Ignoranz gestraft. Er ist eifersüchtig auf die Liebe Joes für seine Eltern, von der er ausgeschlossen ist. Manche Dinge ändern sich eben doch nicht.
Und weil es sich hier um eine schwule Geschichte handelt, sucht Abel seinen Joe nicht an den zu erwartenden Orten, sondern in den Kneipen, in den Saunen, in den Parks und in den Betten früherer Bekanntschaften. Doch ‚Abel und Joe‘ ist mehr als diese Suche, es ist die Bestandsaufnahme eines Umbruchs. Abel, der aus dem Osten Berlins stammt, beobachtet mit Befremden, wie sich die Stadt nach der Eingliederung der DDR in die BDR rund um ihn herum verändert. Auch das Personal der Stadt wird ausgetauscht, für jeden Mann, der stirbt, kommen zwei neue vom Land hinzu. Abel, der sich in seiner Stadt wie ein Tourist zu fühlen beginnt, geht bei seiner Suche in den Dialog mit der Stadt, immer wieder mischen sich Gedankenfetzen und -ströme in den Text. Er ist ein Melancholiker oder auch ein „Griesgram! Poststalinistischer Nostalgiker! Mummel-Unke!“, wie Joes ihm attestiert. Doch wenn dieser Roman eine Moral hat, dann die, dass sich die Zeit nicht aufhalten lässt. Oder um es mit den Worten von Wilhelm Busch zu sagen: „«Eins zwei drei im Sauseschritt eilt die Zeit – wir eilen mit…»“
‚Abel und Joe‘ von Michael Sollorz vollbringt das seltene Kunststück, mühelos einen Teil deutscher, einen Teil Berliner und einen Teil schwuler Geschichte zu erzählen – und das auf gerade einmal 150 Seiten. Das ist eine Leseerfahrung, die auch 30 Jahre später nichts von ihrer Wirkungskraft verloren hat. Und dank der Arbeit des Albino Verlags können sich Leser*innen gemeinsam mit Abel endlich wieder auf die Suche nach Joe begeben.