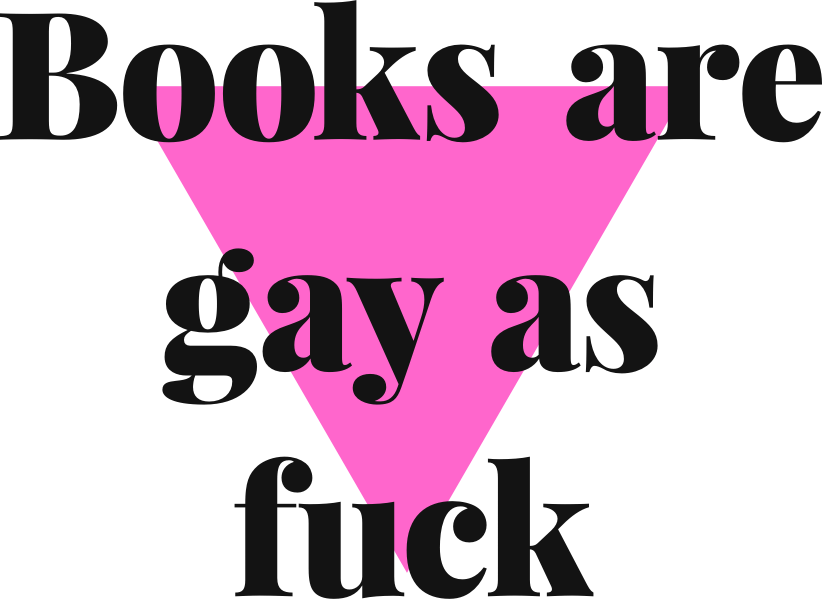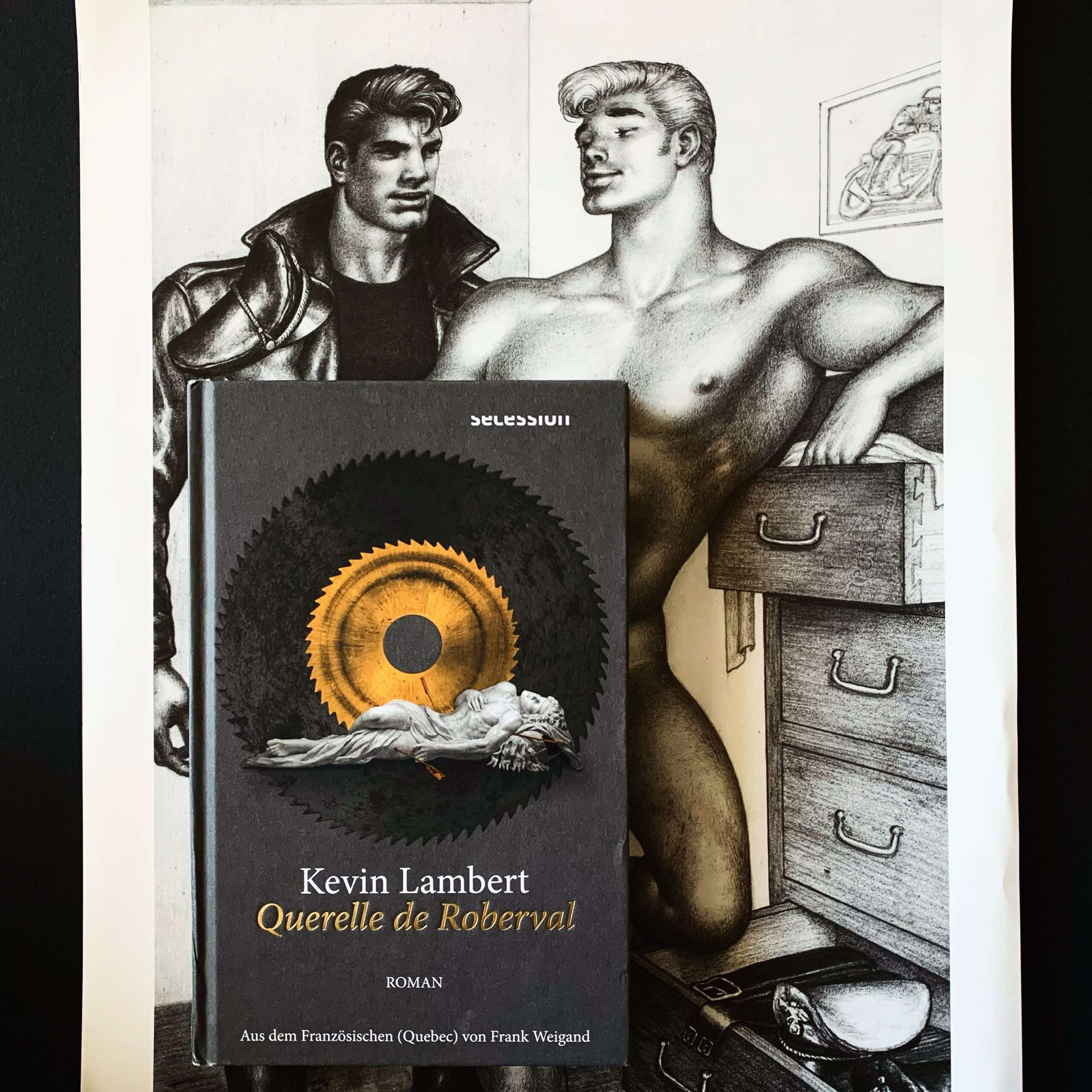„Sie hatten ihre Ästhetik gefunden. Niemand wollte sie, keine Firma, keine Bank, kein Kreditgeber, keine Versicherungsgesellschaft, und plötzlich trafen sie, im Schmerz und in der Qual, auf ein sanftes, freundliches Gesicht, auf eine Herkunft und eine Bestimmung. Sie waren nur Abfall in einem schmutzigen, giftigen Fluss, doch würden sie ganze Häuser mit sich reißen. Nichts besaß mehr Bedeutung, von nun an zählte es nur noch, Böses zu begehen, es zu säen und zu nähren. An diesem Nachmittag schworen sie, sich dem heiligen Auftrag des Schlimmsten zu verschreiben.“
‚Querelle de Roberval‘ von Kevin Lambert (aus dem Französischen (Quebec) und mit einem Nachwort von Frank Weigand) ist Gewerkschaftsfiktion, die anhand eines Streiks in einem Sägewerk eine Gesellschaft beschreibt, die nur noch Wut und keine Solidarität mehr kennt. Der Text vereint die großen Themen unserer Zeit: Globalisierung, Kapitalismus, Tourismus, die Ausbeutung der Natur und indigener Völker, Kolonialismus und die Apathie und Selbstbezogenheit, die im Angesicht dieser Krisen um sich greifen.
Über ein Jahr zieht sich der Streik der Belegschaft im Sägewerk Scierie du Lac inc. für bessere Arbeitsbedingungen. Mittendrin: „Der letzte Neuzugang ist siebenundzwanzig Jahre alt und heißt Querelle. Er kommt aus Montreal, aber seine Eltern sind von hier.“ Doch eigentlich ist dieser Wiedergänger viel älter, ist er doch beseelt von Jean Genets Kultfigur Querelle, so wie auch der gesamte Roman von Jean Genet, Pier Paolo Pasolini, Dennis Cooper und Rainer Werner Fassbinder beseelt ist. Diese explosive Mischung aus Sex und Gewalt muss sich in einer Orgie aus Blut und Sperma entladen, angeführt von Sexgott Querelle, der die Söhne von Roberval allesamt verführt, „die Schlange stehen, um sich ficken zu lassen, er nimmt sie, reiht sie auf wie die Glieder einer Kette, eine hübsche Kette aus jungen Knaben, die er sich um den Hals legt wie unsere Priester ihre Rosenkränze, unsere Chefinnen ihre Perlen.“
Es ist ein sprachliches wie inhaltliches Palimpsest, das Lambert hier so leichtfüßig aus den einzelnen Versatzstücken zusammensetzt und das Frank Weigand ebenso kongenial (an dieser Stelle ist der inflationär verwendete Begriff zu entschuldigen, aber hier trifft er wahrhaftig zu) zu übersetzen wusste: Gewerkschaftsslang, Fachtermini aus der Holzverarbeitung, die blumige Sprache Genets, in die sich aber auch immer wieder die Kälte eines Dennis Cooper schlecht, Hochkultur und Camp, dazwischen Lokalkolorit. Die Stile wechseln einander ab, fließen ineinander über, setzen sich zu einer Melodie der Vielstimmigkeit zusammen.
Im Original spielt Lambert mit dem Pronomen ‚on‘, welches sowohl ‚wir‘ als auch ‚man‘ bedeuten kann. Leser*innen müssen also – wie auch Frank Weigang in seinem extrem informativen Nachwort schreibt – selbst entscheiden, wem ihre Solidarität gilt. Denn Lambert macht es einem nicht so leicht. Die Arbeiter wehren sich zwar gegen die körperliche und finanzielle Ausbeutung ihrer Chefs, gleichzeitig sind sie misogyn, rassistisch und homophob, sie glauben, dass die Frauen ihnen die Jobs in den Fabriken wegnehmen. Aber auch einige der Arbeiterinnen haben es sich in dem System bequem gemacht, sie wehren sich gegen jegliche Protestformen, die sie als zu radikal empfinden, sobald es wehtun könnte, erreichen Verständnis und Solidarität ein schnelles Ende.
Und auch Querelle ist nicht viel besser: „Nachdenken ist nicht unbedingt sein Ding. Einmal, als er eine ureigene Argumentation hervorbrachte, wurde ihm richtig mulmig. Er hatte eine große Leere in sich verspürt, sich gefühlt, als wäre er allein am Rand eines bodenlosen Abgrunds zurückgelassen worden und würde vor aller Augen jeden Halt verlieren. Querelle sind klare, aufbrausende Meinungen lieber als lange, mühsame Erörterungen; hängt sich jemand nur intensiv genug in einen Vortrag rein, so reicht das aus, um auch bei ihm eine Gewissheit zu erzeugen. Wenn er es spürt, muss es auch wahr sein; und umgekehrt, wenn’s wahr ist, muss er’s auch spüren. Ohnehin ist ihm jeglicher Zweifel fremd.“
Querelle ist mehr als er selbst und doch nur das Symbolhafte, all jenes, was die anderen auf ihn und seine Sexualität projizieren. Das Begehren der Söhne Robervals und ihre hungrigen Blicke, wie sie ihn brauchen, um gegen ihre Eltern zu rebellieren und ihrem Leben einen Sinn zu geben, und auch die Blicke der Arbeiter im Sägewerk, die jede seiner Bewegungen verfolgen auf der Suche nach einem Beweis für seine Perversion, doch für seine Twinks hat er alles Jungenhafte abgestreift, ist für sie zum schönen und starken Querelle geworden ist, der Verkörperung des Männlichen, und für ihre Väter und Mütter zum schrecklichen Buhmann, der ihre Kinder verführt und verdirbt. Querelle ist alles in einem, Erlöser und Unheilsverkünder zugleich.
Der Roman ist fest in die Geschichte Quebecs verwurzelt (Ich gehe hier nicht näher darauf ein, das macht das Nachwort viel besser als ich es je könnte), doch gerade wegen der Globalisierungsprozesse, gegen welche die Figuren hier ankämpfen, hat der Roman durchaus einen universellen Charakter. Leser*innen verstehen die Anspielungen, ohne sie zu kennen. Mit ‚Querelle de Roberval‘ hat Kevin Lambert einen bitterbösen Roman vorgelegt, der aber wegen seiner literarischen Spielereien, seiner Weigerung, es seinen Leser*innen einfach zu machen, vor allem auch eines ist: Ein blutiger und spritziger Spaß.