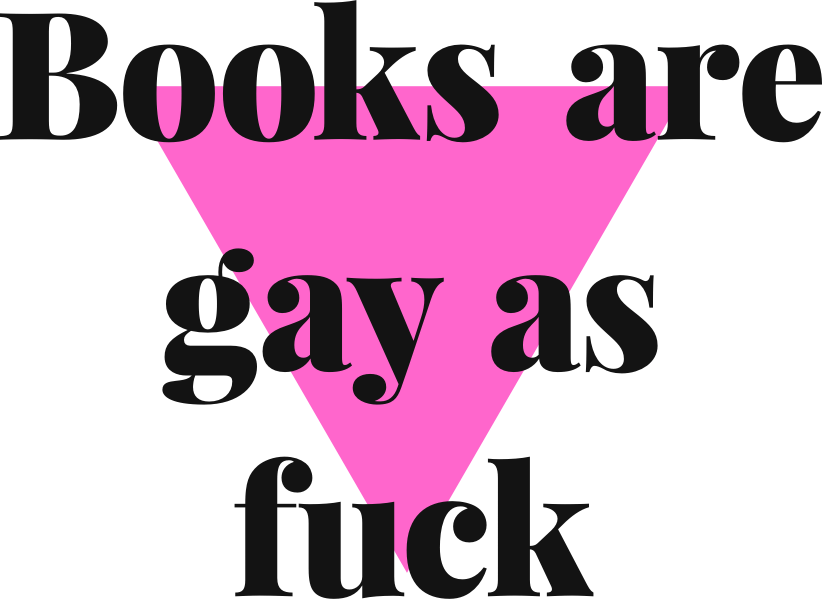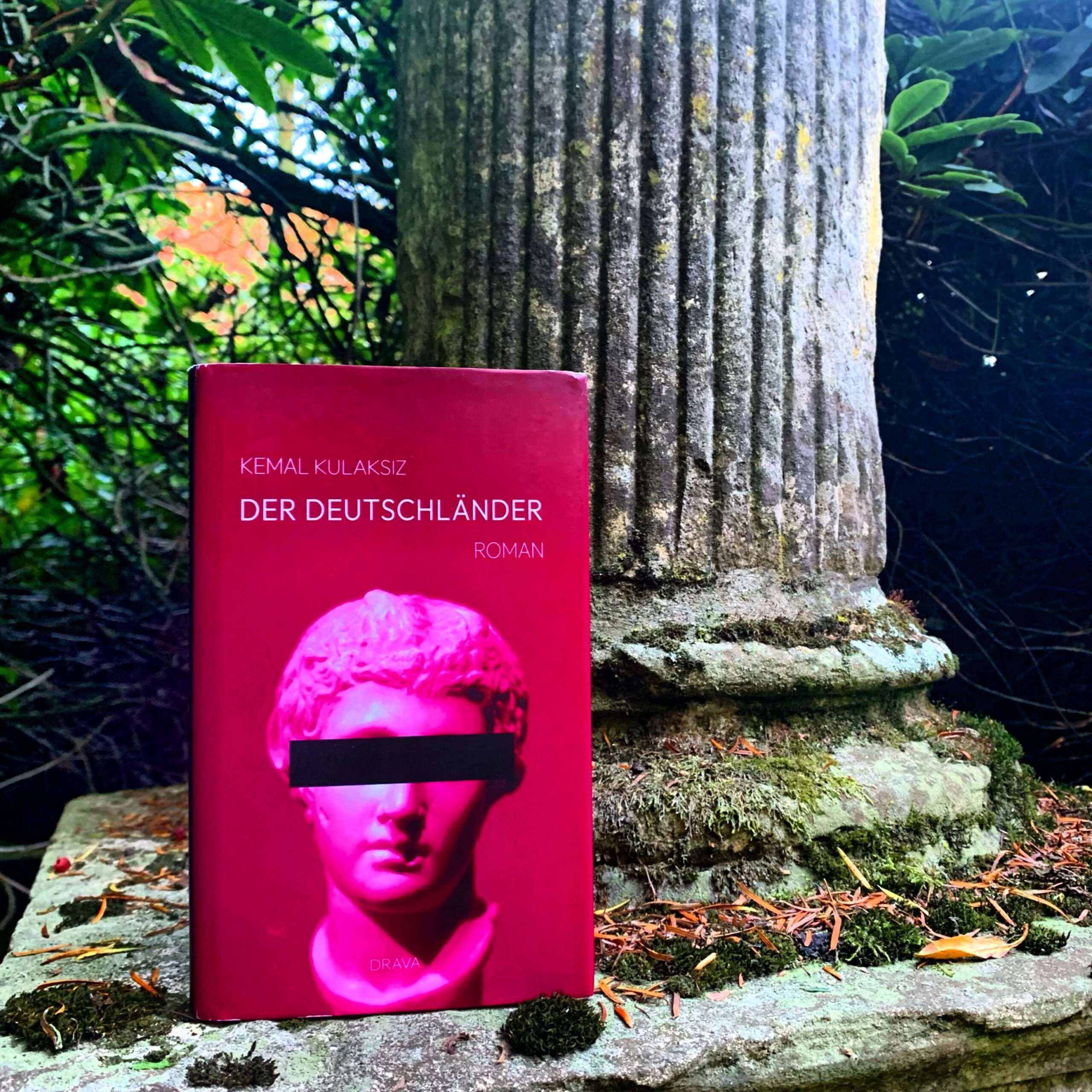„Über sein Leben hatte er die Kontrolle verloren, aber über seine Erinnerungen sollte er doch verfügen können wie es ihm beliebte. Sie waren das Einzige, was er überallhin mitnehmen konnte. Das Einzige, was ihm blieb, wenn ihm nichts mehr blieb. Und wenn er genau darüber keine Kontrolle mehr hätte, was würde das über ihn aussagen?“
‚Der Deutschländer‘, der Debütroman von Kemal Kulaksiz‘, beginnt mit einer Flucht. Doch ist der Auslöser dieser Flucht von Wien nach Istanbul auch der Grund? Oder ist es etwas anderes, ein Strudel aus Bildern und Erinnerungen, der Kâmuran auf den Grund dieses Sees aus Erinnerungen zieht, hinein in den Schlack, aus dem nur für einen Meermann ein Entkommen gäbe?
Als Kâmuran in Istanbul ankommt, hat er nicht mehr als 100 Lira, seinen Pass und sein Handy bei sich. Er flüchtet zu seiner Großmutter, von der er weiß, dass sie keine lästigen Fragen stellen, sich einfach über seinen unangekündigten Besuch freuen wird. Hier kann er geschützt die Anrufe und WhatsApp-Nachrichten seines Freundes Kilian und die Gedanken an das, was vor seiner überstürzten Abreise passiert ist, ignorieren. Natürlich ist nichts so einfach, natürlich ist Kâmuran auch in Istanbul innerlich zerrissen.
Egal, ob on Wien oder in Istanbul, die Menschen sehen in ihm nicht mehr als einen Stellvertreter eines bestimmten Typs, ein Symbol von Vorurteilen. In Istanbul ist er der Deutschtürke, der Almanci, in Wien einer der Türken, jemand, der einer „dieser vielen anderen Sprachen, die man auf der Straße als Lärmbelästigung empfand“, spricht. Kâmuran möchte aus dieser Zwischenwelt entkommen, er möchte wie die kleine Meerjungfrau aus Christian Andersens Märchen jemand anders werden.
Was ihn heimsucht, sind die Erinnerungen an das Aufwachsen in einer Gastarbeiter*innenfamilie in Wien, die Undankbarkeit und der Rassismus, welcher der Familie überall begegnet. Auch innerhalb der Familie, die als Festung im Sturm einer feindlich gesinnten Welt gilt, ist er isoliert. Alle sind sie zu sehr mit den eigenen Problemen beschäftigt, um den maroden Zustand der Festung zu erkennen. Als er sich seiner eigenen Homosexualität bewusst wird, weiß er nicht, ob er sich den Eltern anvertrauen kann oder ob er auch hier auf Vorurteile trifft. Ähnlich sieht es an der Universität aus: der soziale Aufstieg ist nur ein vermeintlicher, jenen privilegierten mit reichen Eltern und einem deutschen Namen stehen alle Türen offen, während sie für ihn weit geöffnet wird, dass er einen Blick in diese für ihn nicht erreichbare Welt erhaschen kann. Dem gegenübergestellt sind die Erinnerungen von Kâmurans Großmutter an seinen mittlerweile verstorbenen Dede, der vor dem Putsch 1971 an Treffen von Anarchisten und Linken teilgenommen hat, aber auch ihre eigene Geschichte, die von den gesellschaftlichen Grenzen, die ihr als Frau auferlegt wurden, geprägt sind. Hier zeigt sich der Roman von seiner stärksten Seite.
Der Roman ist an keiner Lösung dieser Probleme interessiert. Vielmehr zeigt Kulaksiz, wie Kâmuran, auf sich selbst in der Ferne zurückgeworfen, von diesen niedergezwungen wird. Das erzählt der Text sehr klassisch, recht unaufgeregt und sehr unmittelbar. An einigen Stellen lässt Kulaksiz sich dann aber doch dazu verleiten, Lesende zu sehr an die Hand zu nehmen, anstatt diese mit einer Verlorenheit zu konfrontieren ähnlich wie sie auch Kâmuran empfindet. Deswegen ist der Roman für mein Empfinden zum Ende hin in seinen Referenzen bzw. in der Interpretation dieser zu eindeutig, hier hätte ich mir mehr Offenheit gewünscht. Diese kleineren Kritiken sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ‚Der Deutschländer‘ ein lesenswertes Debüt ist über innere Zerrissenheit, Zugehörigkeit und den Wunsch, dem engmaschigen Netz äußerer Zuschreibungen in Richtung Freiheit zu entkommen.